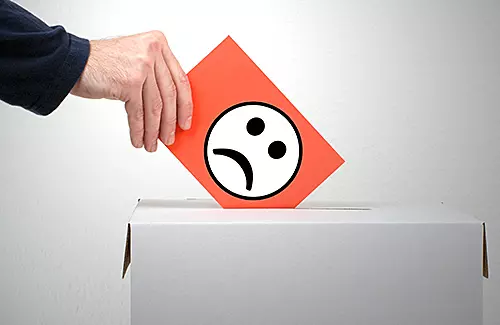Die Betriebliche Beschwerdestelle nach § 13 AGG: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Alles Wichtige in Kürze für Unternehmen!
Warum brauchen Unternehmen eine Beschwerdestelle? | Pflicht zur Einrichtung einer Beschwerdestelle | Wer kann als Beschwerdestelle fungieren? | Qualifikationen für eine Beschwerdestelle |
Zugang zur Beschwerdestelle | Was macht die Beschwerdestelle? | Beschwerdestelle gemäß Lieferkettengesetz | Praxisbeispiele
| AUF DEN PUNKT Jeder kann sich beschweren: Das Beschwerderecht hat jedes Belegschaftsmitglied, so auch:
|
Warum brauchen Unternehmen eine Beschwerdestelle?
Dazu zählen:
- ethnische Herkunft oder Rasse
- Geschlecht
- Religion oder Weltanschauung
- eine Behinderung
- das Alter
- die sexuelle Identität
Pflicht zur Einrichtung einer Beschwerdestelle
Laut § 13 AGG sind Unternehmen verpflichtet, eine Beschwerdestelle einzurichten, an die sich Mitarbeitende wenden können, wenn sie sich aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter oder sexueller Identität benachteiligt fühlen. Diese gesetzliche Verpflichtung gilt für alle Arbeitgeber, unabhängig von der Unternehmensgröße. Verstößt ein Unternehmen gegen diese Pflicht, kann dies arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Wer kann als Beschwerdestelle fungieren?
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) schreibt vor, dass Beschäftigte sich bei einer zuständigen Stelle im Unternehmen beschweren können, wenn sie sich im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses benachteiligt fühlen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Stelle liegt dabei im Gestaltungsspielraum des Arbeitgebers. Gesetzlich ist nicht festgelegt, wie genau die Beschwerdestelle strukturiert oder personell besetzt sein muss – es bleibt Aufgabe der Unternehmensorganisation, eine funktionsfähige und vertrauenswürdige Lösung zu schaffen.
Grundsätzlich kann die Beschwerdestelle intern oder extern organisiert werden. Intern bieten sich verschiedene Möglichkeiten an: Häufig wird die Personalabteilung, eine Compliance-Einheit oder eine speziell benannte Vertrauensperson mit der Aufgabe betraut. In kleineren Unternehmen kann auch eine geschulte Einzelperson, beispielsweise aus dem Kreis der Führungskräfte, diese Funktion übernehmen. Wichtig ist, dass die Beschwerdestelle als unabhängig wahrgenommen wird und das Vertrauen der Belegschaft genießt. In Betrieben mit Gleichstellungsbeauftragten kann auch diese Rolle sinnvoll eingebunden werden.
Externe Lösungen – etwa über eine Ombudsstelle oder eine unabhängige Beratungsstelle – bieten sich vor allem dann an, wenn ein besonderes Maß an Neutralität oder Datenschutz notwendig ist. Externe Stellen können zudem helfen, Hemmschwellen abzubauen, insbesondere bei sensiblen Themen wie sexueller Belästigung oder Diskriminierung aufgrund geschützter persönlicher Merkmale.
In größeren Unternehmen kann eine zentrale Beschwerdestelle für alle Betriebsstandorte eingerichtet werden, sofern sichergestellt ist, dass alle Beschäftigten einen einfachen und zumutbaren Zugang zu dieser Stelle haben. Eine rein konzernweite Anlaufstelle – z.B. bei der Holding – genügt jedoch nicht den gesetzlichen Anforderungen, da § 13 AGG ausdrücklich eine Stelle im Betrieb oder Unternehmen fordert. Insbesondere im öffentlichen Dienst ist die Pflicht zur Einrichtung in jeder einzelnen Dienststelle strikt zu beachten.
Für die Beschäftigten muss klar erkennbar sein, wer die Rolle der Beschwerdestelle übernimmt. Die Zugänglichkeit ist entscheidend: Eine Beschwerdestelle, die organisatorisch zwar benannt ist, faktisch aber schwer erreichbar oder gar unbekannt ist, verfehlt ihren Zweck.
Aus Gründen der Vertrauensbildung empfiehlt sich zudem eine geschlechterdiverse Besetzung der Beschwerdestelle. Bei Themen wie sexueller Belästigung ist es sinnvoll, dass betroffene Personen die Wahlmöglichkeit haben, sich an eine gleichgeschlechtliche Ansprechperson zu wenden.
Rechtlich ist die Einrichtung der Beschwerdestelle keine mitbestimmungspflichtige Maßnahme im Sinne von § 87 Abs. 1 BetrVG. Weder die organisatorische Ansiedlung noch die personelle Besetzung unterliegen der Mitbestimmung des Betriebsrats, wie das Bundesarbeitsgericht bereits 2009 klargestellt hat. Es handelt sich vielmehr um eine originäre Verpflichtung des Arbeitgebers zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben.

Qualifikationen für eine Beschwerdestelle
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) macht keine verbindlichen Vorgaben dazu, welche Qualifikationen eine Person mitbringen muss, um als Beschwerdestelle benannt zu werden. Dennoch ist es im Interesse eines wirksamen Beschwerdemanagements unabdingbar, dass die betrauten Personen über geeignete fachliche und persönliche Kompetenzen verfügen. Eine gute Beschwerdestelle zeichnet sich durch folgende Eigenschaften und Fähigkeiten aus:
- Fundiertes Wissen über das AGG sowie über weitere arbeitsrechtliche Regelungen, insbesondere zu Diskriminierungsschutz, Beteiligungsrechten und internen Meldewegen
- Vertraulichkeit und Unparteilichkeit im Umgang mit sensiblen Informationen
- Kommunikationsstärke und Konfliktlösungskompetenz
- Sensibilität im Umgang mit emotional belastenden Themen
- Erfahrung im Umgang mit strukturellen Konflikten und interner Vermittlung
- Psychologisches Grundverständnis
Auch wenn Schulungen gesetzlich nicht vorgeschrieben sind, ist eine gezielte Qualifizierung der zuständigen Person(en) ausdrücklich empfehlenswert. Insbesondere die Kenntnis des korrekten Ablaufs eines Beschwerdeverfahrens und der damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen ist essenziell.
Je nach Unternehmensgröße und vorhandenen Ressourcen kann dies durch externe Seminare, interne Schulungsprogramme oder durch unterstützende Materialien wie Handlungsleitfäden erfolgen. Eine professionelle Qualifikation der Beschwerdestelle ist somit kein rechtliches Muss – aber ein entscheidender Erfolgsfaktor für ein funktionierendes, glaubwürdiges und wirksames Beschwerdemanagement im Unternehmen.
Zugang zur Beschwerdestelle
Die Wirksamkeit einer Beschwerdestelle hängt maßgeblich davon ab, wie gut sie im Unternehmen bekannt ist und wie unkompliziert sie erreichbar ist. Arbeitgeber sind deshalb verpflichtet, die Existenz und die Kontaktmöglichkeiten der Beschwerdestelle aktiv und fortlaufend zu kommunizieren. Eine einmalige Erwähnung – etwa bei der Einstellung – genügt in der Regel nicht. Vielmehr sollte die Information regelmäßig und über verschiedene Kanäle bereitgestellt werden.
Geeignete Kommunikationswege sind unter anderem:
- gut sichtbare Aushänge im Betrieb
- Informationen im Intranet
- Hinweise in Schulungsunterlagen oder Handbüchern für Mitarbeitende
- regelmäßige Unterweisungen oder thematische Veranstaltungen
- direkte Hinweise im Rahmen von Onboarding-Prozessen
Ebenso wichtig wie die Bekanntmachung ist ein niedrigschwelliger und barrierefreier Zugang zur Beschwerdestelle. Beschäftigte müssen jederzeit die Möglichkeit haben, auf einem für sie geeigneten Weg Kontakt aufzunehmen – ohne Angst vor Repressalien oder dem Verlust von Anonymität.
Der Schutz der meldenden Person steht dabei an oberster Stelle. Die Identität von Hinweisgebenden ist – sofern gewünscht – vertraulich zu behandeln, um mögliche Ängste vor Benachteiligung, Ausgrenzung oder beruflichen Nachteilen zu minimieren. Eine klar geregelte Vertraulichkeit sowie transparente Verfahrensregeln stärken das Vertrauen in die Beschwerdestelle und erhöhen die Bereitschaft, von diesem wichtigen Instrument Gebrauch zu machen.


Was macht die Beschwerdestelle?
Die Hauptaufgaben der Beschwerdestelle umfassen:
- Entgegennahme und Dokumentation von Beschwerden
- Prüfung des Sachverhalts und erste Einschätzung
- Klärung mit der betroffenen Person, ob und welche Maßnahmen gewünscht sind
- Einleitung von Untersuchungen und Gesprächen mit den Beteiligten
- Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für den Arbeitgeber
- Unterstützung von Maßnahmen zur Konfliktlösung oder Sanktionierung
- Pflicht zur Einrichtung einer Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz
Beschwerdestelle gemäß Lieferkettengesetz
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verlangt von großen Unternehmen (ab 3.000 Mitarbeitenden, ab 2024 ab 1.000 Mitarbeitenden), eine Beschwerdestelle für menschenrechtliche und umweltbezogene Verstöße in der Lieferkette einzurichten. Diese Funktion unterscheidet sich von der AGG-Beschwerdestelle, kann aber durch ein gemeinsames Meldeverfahren effizient umgesetzt werden.
Praxisbeispiele
Beispiel 1: Diskriminierung aufgrund des Geschlechts
Eine Mitarbeiterin fühlt sich aufgrund sexistischer Kommentare eines Vorgesetzten diskriminiert. Sie meldet den Vorfall der Beschwerdestelle. Nach einer internen Untersuchung und Gesprächen mit beiden Parteien wird eine Schulung zu diskriminierungsfreier Kommunikation durchgeführt und eine Verwarnung ausgesprochen.
Beispiel 2: Altersdiskriminierung
Ein älterer Mitarbeiter erhält keine Beförderung, obwohl er die Qualifikationen erfüllt. Nach einer Beschwerde wird das Auswahlverfahren geprüft und eine unbewusste Altersdiskriminierung festgestellt. Das Unternehmen ändert daraufhin sein Beförderungsverfahren.
Beispiel 3: Anonyme Meldung über ein Hinweisgebersystem
Ein anonymer Hinweis auf ungleiche Gehaltsstrukturen zwischen männlichen und weiblichen Beschäftigten geht ein. Die Beschwerdestelle lässt eine externe Prüfung der Gehaltsstrukturen durchführen, woraufhin Anpassungen vorgenommen werden.


Fazit
Eine betriebliche Beschwerdestelle ist mehr als eine gesetzliche Pflicht – sie ist ein essenzieller Bestandteil einer diskriminierungsfreien Unternehmenskultur. Unternehmen sollten sicherstellen, dass ihre Beschwerdeprozesse transparent, zugänglich und wirksam sind, um Vertrauen und Fairness im Betrieb zu fördern.